Das Erotische in der Natur ist allgegenwärtig. Nicht, weil Schäferstündchen gern im…
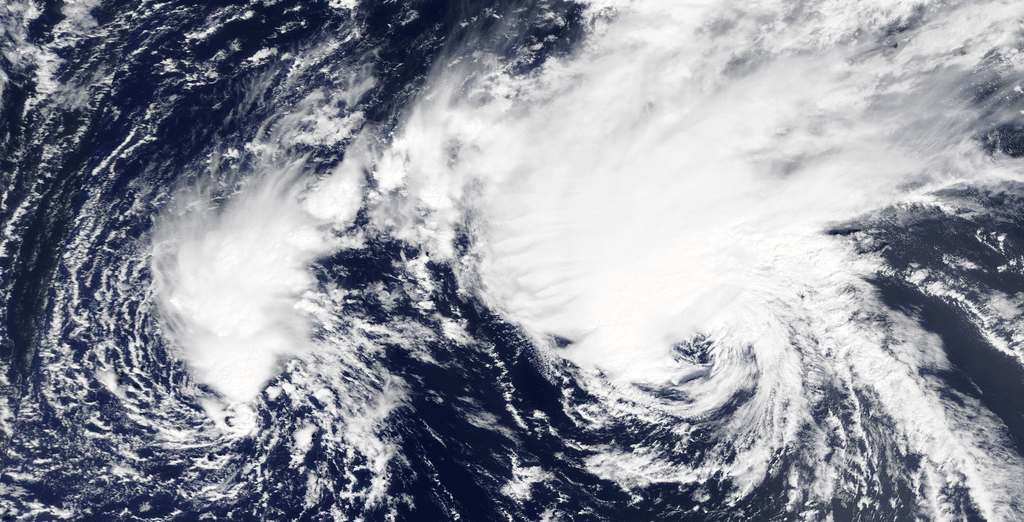
Dass die Welt sich wandelt, ist als philosophische Erkenntnis trivial. Dass permanenter und forcierter Wandel Menschen überfordert, ebenso. Dass aber der Turbowandel, mit dem Unternehmen, Staat und Gesellschaft es seit einigen Jahren zunehmend zu tun haben, anderen Zielen dienen können als den gemeinhin behaupteten, ist wohl die eine oder andere Überlegung wert. Denken wir ein wenig über Change nach.
Change als Schlagwort für Veränderungsprozesse in der Wirtschaft ist seit den 90ern präsent. Der auf ökonomische Belange bezogene Begriff ist sozusagen die zivile Variante des wesentlich älteren Begriffs Regime Change – die Ableitung ist, wie wir später sehen werden, keine zufällige.
Change in Unternehmen und Institutionen
Zunächst erfasste Change vor allem die großen, global agierenden Unternehmen. Inzwischen dürfte es kaum noch ein mittelständisches Unternehmen von Bedeutung geben, das noch keinen Changeprozess durchlaufen hat bzw. nicht in einer ganzen Kette von Changeprozessen gefangen wäre. Selbst staatliche und halbstaatliche Institutionen – von Natur aus eher zu Trägheit und Behäbigkeit neigend – verschreiben sich längst dem Change.
Change betrifft alle Bereiche unternehmerischen und institutionellen Handelns. Oft ist damit die sogenannte digitale Transformation gemeint, doch auch interne Abläufe, Hierarchien, Organisationsfragen, Personalplanung und andere Dinge unterliegen dem Change. Ziel ist es, das jeweilige Unternehmen zukunftsfähig zu machen – schneller, flexibler, agiler, motivierter, dynamischer. Auch geht damit oft das Versprechen einher, dass bestimmte Abläufe einfacher, sicherer und zeitsparender gestaltet würden. Doch stimmt das?
Bei nüchterner Betrachtung kommt man zu der Einsicht, dass Change eben nicht vorrangig dazu dient, bessere Produkte an den Markt zu bringen oder organisatorische Abläufe zu verbessern – Change will vor allem das Neue. Wenn der Kunde genötigt wird, Dinge selbst zu machen, die bislang – etwa im Geldverkehr – die Institution für ihn ausführte, ist das zwar neu, aber nicht besser. Auch Elektroautos sind nicht besser. Sie ersetzen lediglich alte Nachteile durch neue. Das Neue aber wird grundsätzlich als das Bessere ausgegeben – dies gelingt mühelos, weil gleichzeitig die Vergangenheit zunehmend als Hort des Schlechten, Unfreien, Verwerflichen und Unmenschlichen vorgeführt wird. Change hingegen steht immer für eine bessere Welt. So hält man das Schwungrad des Konsums in Betrieb – wer sich daran nicht beteiligt, muss überzeugt werden, es zu tun. Doch um welchen Preis?
Change macht krank
Beschäftigte als vorrangig vom Wandel Betroffene erleben Change vor allem als Stress: Ständig neue Aufgaben, neue Technologien, neue Vernetzungszwänge, neue Vorgesetzte, neue Gesichter im Kollegenkreis, neue Produkte oder neue Einsatzorte erzeugen durch schnelle Taktung und massive Häufung von Änderungen ein Gefühl der Unsicherheit, das die bekannten Stresssymptome auslöst wie beispielsweise das Gefühl der Überforderung, Schlaflosigkeit, Magen-Darmstörungen, Lust- und Antriebslosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Kopfschmerz, Verspannungen, Depressionen. In der Folge entstehen nicht selten Medikamentenabhängigkeit oder Alkohol- und Drogensucht. Der unter Change leidende Mensch zieht sich aus seinem sozialen Umfeld zurück, isoliert sich. Zusätzlich begünstigt wird diese Isolation dadurch, dass Changeprozesse mit zusätzlichen zeitlichen und organisatorischen Belastungen wie Fortbildungen und Schulungen verbunden sind. Hinzu kommen noch all die kleinen Veränderungen, die in das Privatleben eingreifen und zusätzlichen Druck erzeugen – von Strom- und Handytarifen über Fragen der Altersversorgung angesichts der Nullzinspolitik bis hin zu Ernährungs-, Gesundheits- und Erziehungsfragen.
Natürlich: Veränderungen gab es schon immer. Und nicht immer waren die von Veränderungen Betroffenen davon begeistert. Doch was die Veränderungen früherer Zeiten vom Change des Heute unterscheidet, ist die gnadenlose Permanenz, die keine Ruhezonen mehr kennt, alle Fluchtwege absperrt und im Bonmot „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“ eine unmissverständliche Drohung ausspricht, sich dem Wandel ja nicht zu verschließen.
Die nach außen eigentlich mit dem Change-Prinzip verbundene Erwartungshaltung, durch Motivationssteigerung das Unternehmen zukunftsfähig zu machen, dürfte dabei weitgehend auf der Strecke bleiben. Es kommt vielmehr zu krankheitsbedingten Ausfällen, epidemischer Unzufriedenheit, inneren Kündigungen und schlechterer Leistung. Nimmt man hinzu, dass permanenter Wandel dazu führt, dass Unternehmen nur noch mit sich selbst beschäftigt sind, wird begreiflich, dass Change nicht nur die Beschäftigten, sondern die Unternehmen im Ganzen eher schwächt als stärkt. Change ertüchtigt nicht für die Zukunft, Change raubt Kräfte.
Change hat also nicht den Charakter einer der Gesundheit dienenden Therapie, die sich über einen bestimmten, begrenzten Zeitraum hinzieht und an deren Ende mehr Leistungs- und Widerstandsfähigkeit steht. Im Gegenteil: Change hat die Neigung, sich wie ein Krankheitserreger in den befallenen Organisationen einzunisten und sich dort zu verselbständigen. Wie manche Parasiten übernimmt Change die Kontrolle über den Wirt und steuert ihn. Change endet nie und zerstört immer.
In wessen Interesse aber könnte es liegen, Unternehmen dennoch in komplexe und langwierige Change-Prozesse zu zwingen?
Change in Staat und Gesellschaft
Change ist nicht allein auf die Wirtschaft beschränkt. Betrachtet man die gesellschaftlichen Umwälzungen allein der letzten fünf Jahren und die damit einhergehenden Änderungen der strukturellen und rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland, kann man sich des Verdachts nicht erwehren, dass auch hier das Change-Prinzip durchgesetzt werden soll – auf die gleiche massive, störende und zerstörende, komplexe und gewalttätige Weise, wie es in Unternehmen geschieht. Und mit ähnlichen Folgen. Man könnte sagen, dass die Regeln des Zusammenlebens inzwischen tatsächlich täglich neu ausgehandelt werden müssen – nicht nur zwischen den Ethnien und Religionen, sondern überall. Es bleibt kein Stein auf dem anderen, alles ändert sich. Was gestern noch als sicher galt – die Renten, die Grenzen, ganze Industrien und nicht zuletzt das klassische Familienmodell – wird heute in Frage gestellt bzw. ist dem gewollten und geförderten Verfall preisgegeben.
Ähnlich wie in den Unternehmen den Beschäftigten, wird hier den Mitgliedern des Gemeinwesens, den Staatsbürgern, vorgegaukelt, es ginge bei solchen Transformationsprozessen um die Herstellung und Sicherung der Zukunftsfähigkeit. Ähnlich wie in den Unternehmen gibt es jedoch keinerlei echte Transparenz hinsichtlich der Frage, was genau geschieht und warum es geschieht und welche Folgen es haben wird. Ähnlich wie in der Welt der Wirtschaft darf man davon ausgehen, dass auch hier der Change-Prozess niemals ein Ende finden wird.
Und genau wie in den Unternehmen werden durch die so erzeugten Verwirrungen und Irritationen Unsicherheiten auf breiter Ebene erzeugt, die dazu führen, dass der Staatsbürger sich vornehmlich um sich selbst zu kümmern genötigt sieht und ihm keinerlei Zeit- und Energieressourcen mehr bleiben, sich verantwortlich um das Gemeinwesen zu kümmern. So werden Wachsamkeit und Kritikfähigkeit im Ansatz erstickt. Willfährige, leicht steuerbare Menschen werden so gezüchtet – in den Unternehmen wie im politischen Gemeinwesen.
Permanenter Veränderungsdruck erzieht den perfekten Untertanen
Die Methode hat System: Man macht die Leute mürbe und sorgt so dafür, dass der angestoßene Change-Prozess – eine Art permanenter Revolution – niemals an ein Ende kommen wird.
Dabei geht es nicht nur um die großen Ereignisse – auch ganz alltägliche, nebensächliche Dinge unterliegen dem permanenten Wandel. Hier werden Glühlampen und leistungsstarke Staubsauger vom Markt genommen, dort werden unsinnige Vorschriften oder Verbote erlassen oder sonstige vorgeblich alternativlose Neuerungen durchgesetzt. Doch Selbstzweck ist Change auch in diesen Zusammenhängen nicht.
Change auf politischer Ebene ist immer auch Regime Change – in den Industriegesellschaften geschieht dies jedoch nicht durch abrupte Umstürze, sondern schleichend. Ein probates Mittel der Durchsetzung auf die sanfte Tour ist das Nudging – Ziel ist das Erreichen von Verhaltensänderungen durch kleine Anstöße und Belohnungen, die den solchermaßen Gelenkten am Ende glauben lassen, er selbst sei auf die Idee gekommen.
Wem aber nützt es? Wer könnte ein Interesse daran haben, dass bewährte Strukturen zerstört, Lebensmodelle zerschlagen und Unsicherheiten erzeugt werden? Wem nützen Bürger, die ihre Interessen nicht mehr wahrnehmen können, weil sie durch permanente Änderungsanforderungen überfordert sind und jedes Engagement für das Gemeinwesen irgendwann als sinnlos ansehen werden?
Gibt es etwa eine im Verborgenen wirkende Weltregierung, die den globalen Konzernen und den Regierungen der Staaten vorgeben, was sie zu tun haben? Oder ist es die globalisierte Wirtschaft selbst, die ein Interesse daran haben könnte, einem Menschenschlag zur Durchsetzung zu verhelfen, der intelligent genug ist, um in Arbeits- und Konsumbelangen zu funktionieren, gleichzeitig aber nicht intelligent genug, um dieses System zu kritisieren? Stecken am Ende gar finstere Ideologen dahinter, die ihre Vorstellungen von der absoluten Gleichheit der Menschen, Rassen und Begabungen mithilfe der Wirtschaft und Politik durchsetzen wollen? Oder ist es nur ein Automatismus – man spricht dann gern von Sachzwängen –, der hier inzwischen waltet? Vielleicht ist es von allem etwas? Wir wollen uns nicht im Spekulativen verlieren. Viel wichtiger wäre es, zu untersuchen, wie Change gestoppt werden kann.
Change stoppen – zwei Ansatzpunkte
Schaut man sich an, welche Strategien Changeberater anwenden, um in Firmen und Institutionen die Belegschaften fit zu machen für den Wandel – sprich: sie anpassungsbereit zu machen –, stößt man immer wieder auf zwei Faktoren: Zum einen soll eine Ertüchtigung im Sinne der Resilienz als Widerstandskraft der Seele dafür sorgen, dass die unter Change Leidenden psychisch stabil bleiben bzw. es wieder werden. Zum anderen werden Kreativitätstechniken angewandt, um den Changeprozess noch dynamischer und agiler zu gestalten.
Weder Resilienz noch Kreativität sind jedoch von Natur aus als Hilfsmittel für die Architektur des permanenten Change gedacht. Im Gegenteil. In beiden Fällen wird sich zeigen, dass sowohl Resilienz als auch Kreativität eine enorme Sprengkraft haben. Die kann genutzt werden, Change anzugreifen und dem permanenten Wandel etwas dauerhaft Bleibendes entgegenzustellen, das die unheilvolle Dynamik zum Erliegen bringt. Was genau bedeutet Resilienz, was Kreativität?
Die Resilienzforschung zielte in ihren Anfängen darauf ab, herauszufinden, welche Faktoren und persönlichen Eigenschaften Menschen stärken. Dabei ging es besonders um Menschen in Kampfeinsätzen, die auch in Gefangenschaft geraten konnten: Wie leicht würde ihr Wille zu brechen sein, wie leicht würden sie in Kooperationen einwilligen? Man kam zu dem Ergebnis, dass vor allem diejenigen Menschen, die in festen sozialen Bindungen lebten, am widerstandsfähigsten waren. Also enge familiäre Bindungen hatten, in Kirchen und Vereinen organisiert waren, Freundschaften pflegten. Auch der Glaube und das Gefühl, ein sinnerfülltes Leben zu leben, zählt zu den Resilienz erzeugenden Faktoren. Change zielt sowohl in der Wirtschaft als auch auf gesellschaftlicher und politischer Ebene in wesentlichen Teilen darauf ab, genau diese starken Bindungen zu zerstören – das zum sozialen Atom vereinzelte Individuum soll dem Wandel ja gerade nichts entgegensetzen können.
Stattdessen wird unter dem Vorzeichen von Change Resilienz umgedeutet – die Faktoren, die es Beschäftigten erleichtern sollen, den Wandel zu ertragen, sind jetzt allesamt im Wandel selbst angelegt. Familie, Kultur, Religion spielen da keine Rolle mehr. Von zentraler Bedeutung ist jetzt, dass man den Prozess des permanenten Wandels selbst als sinnhaft erlebt und an den Sinn der jeweiligen Neuerung glaubt – das schafft, so hofft man, Bindung an den Wandel. Eine auf Dauerhaftigkeit angelegte Bindung zum permanenten Wandel aber ist im Kern widersinnig – genau hier liegt eine der Sollbruchstellen des Changeprinzips. Führen wir den Resilienzbegriff auf seine Ursprünge zurück (Familie, Kultur, Religion), gewinnt er seine widerständige Kraft zurück und kann gegen Change gewendet werden.
Ähnlich verhält es sich mit dem Faktor Kreativität. Kreativität ist ihrem eigentlichen Sinn nach nichts anderes als die Kraft des menschlichen Geistes, die Dinge auch ganz anders sehen und gestalten zu können, als die gerade herrschende Mode es vorschreiben möchte. Kreativität in diesem Verständnis hat also nichts mit jenen kleinen Machenschaften zu tun, die heute flächendeckend eingesetzt werden, um die Produktivität zu erhöhen oder die Konsumlust zu steigern.
Kreativität hat neben ihrer schöpferischen, hervorbringenden und gestaltenden auch eine stark zerstörerische Seite. Kreativität ist im Kern anarchisch. Die Lust an der kreativen Zerstörung ist eine geradezu göttliche Urlust des Menschen. Befreit er sich zu dieser Lust, wird es ihm ein Leichtes, die zerstörerischen Tendenzen des Change selbst anzugreifen und sie ihrerseits zu zerstören. Man muss nur den Punkt erreichen, an dem man sagt: Schluss jetzt. Ich befreie mich zu mir selbst. Ich werde die Welt anders sehen und verstehen – und eben nicht so, wie die Diktatur des Change es mir aufzwingen möchte.
Foto: NASA


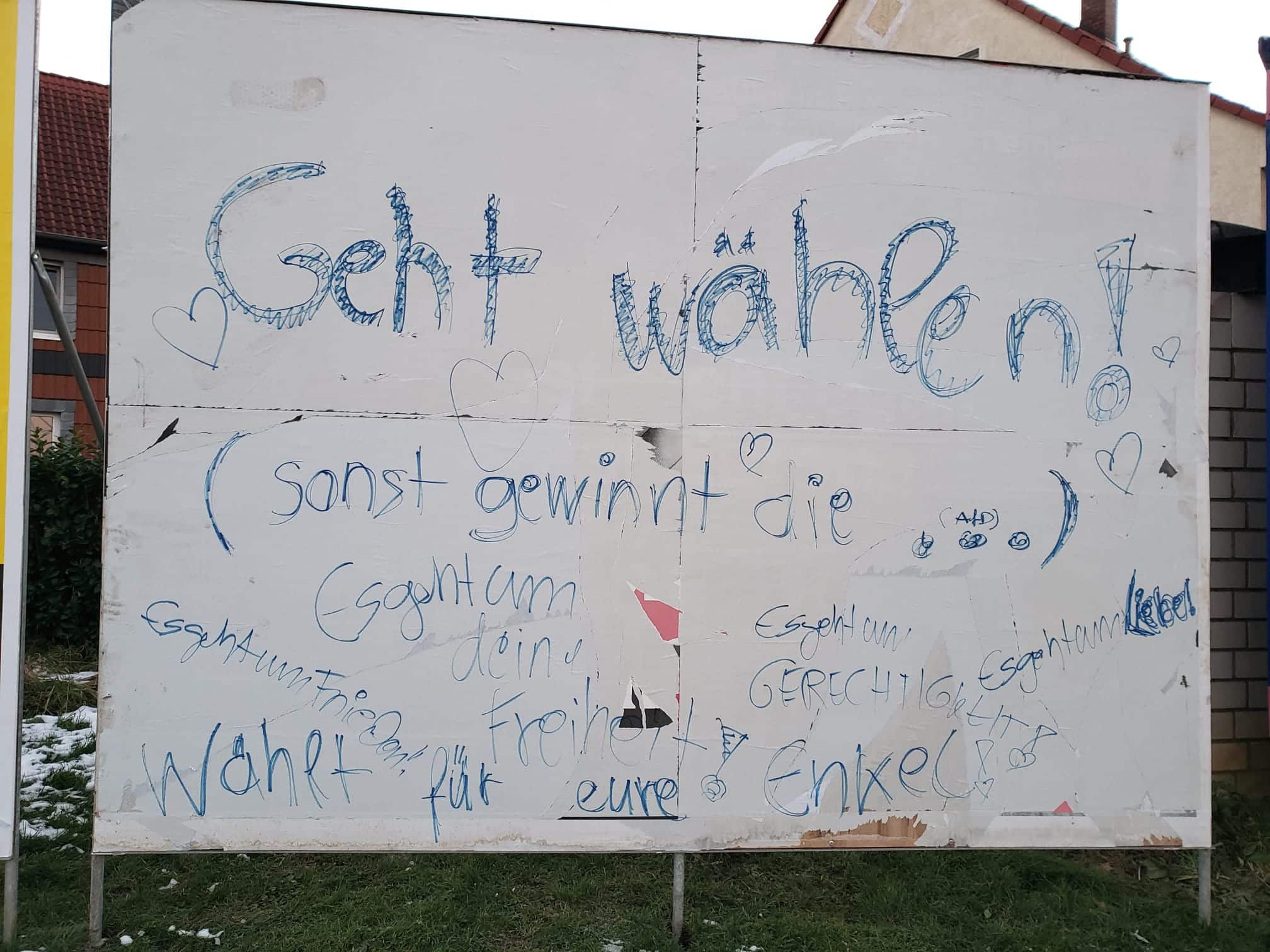
Comments (0)